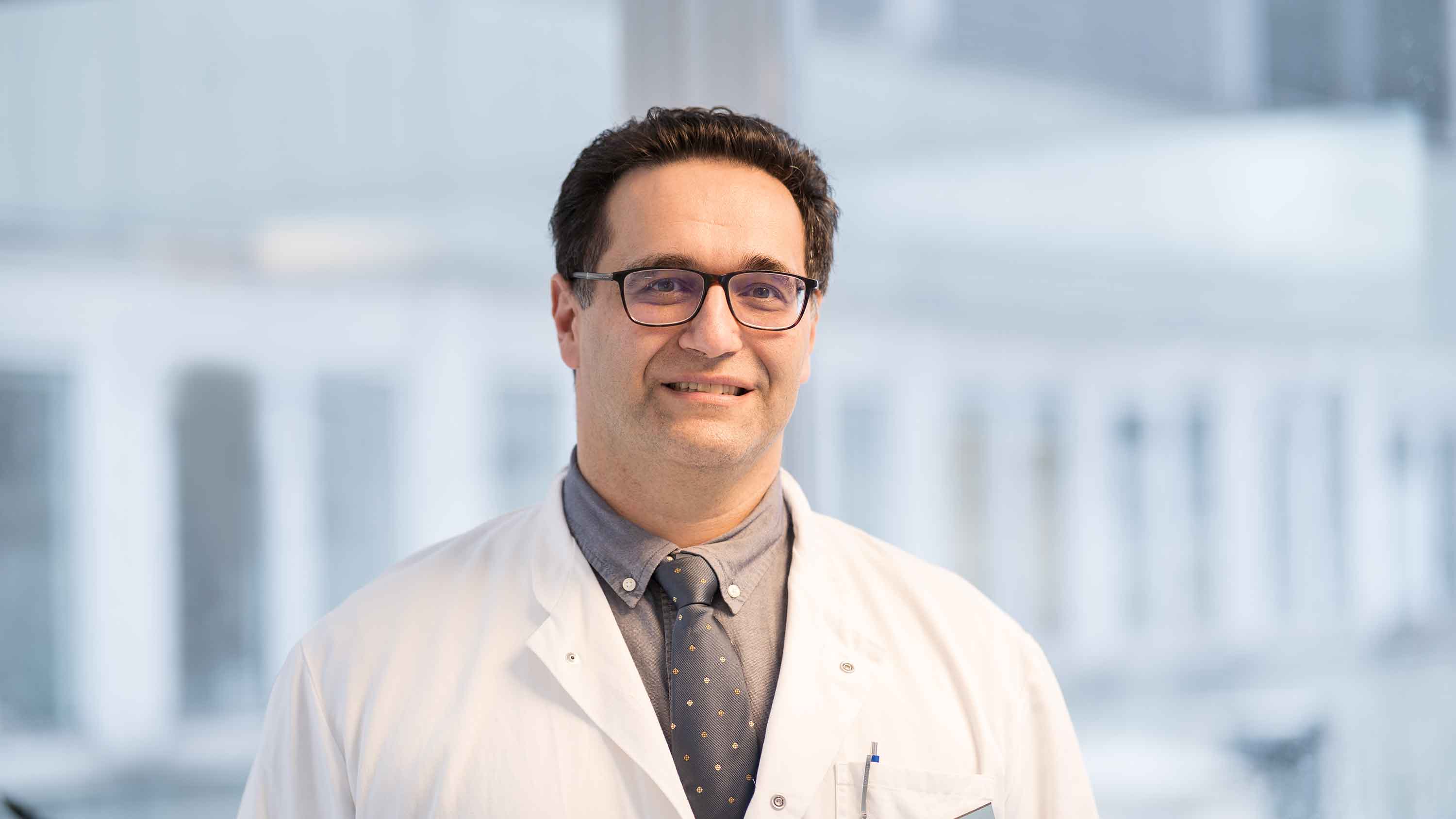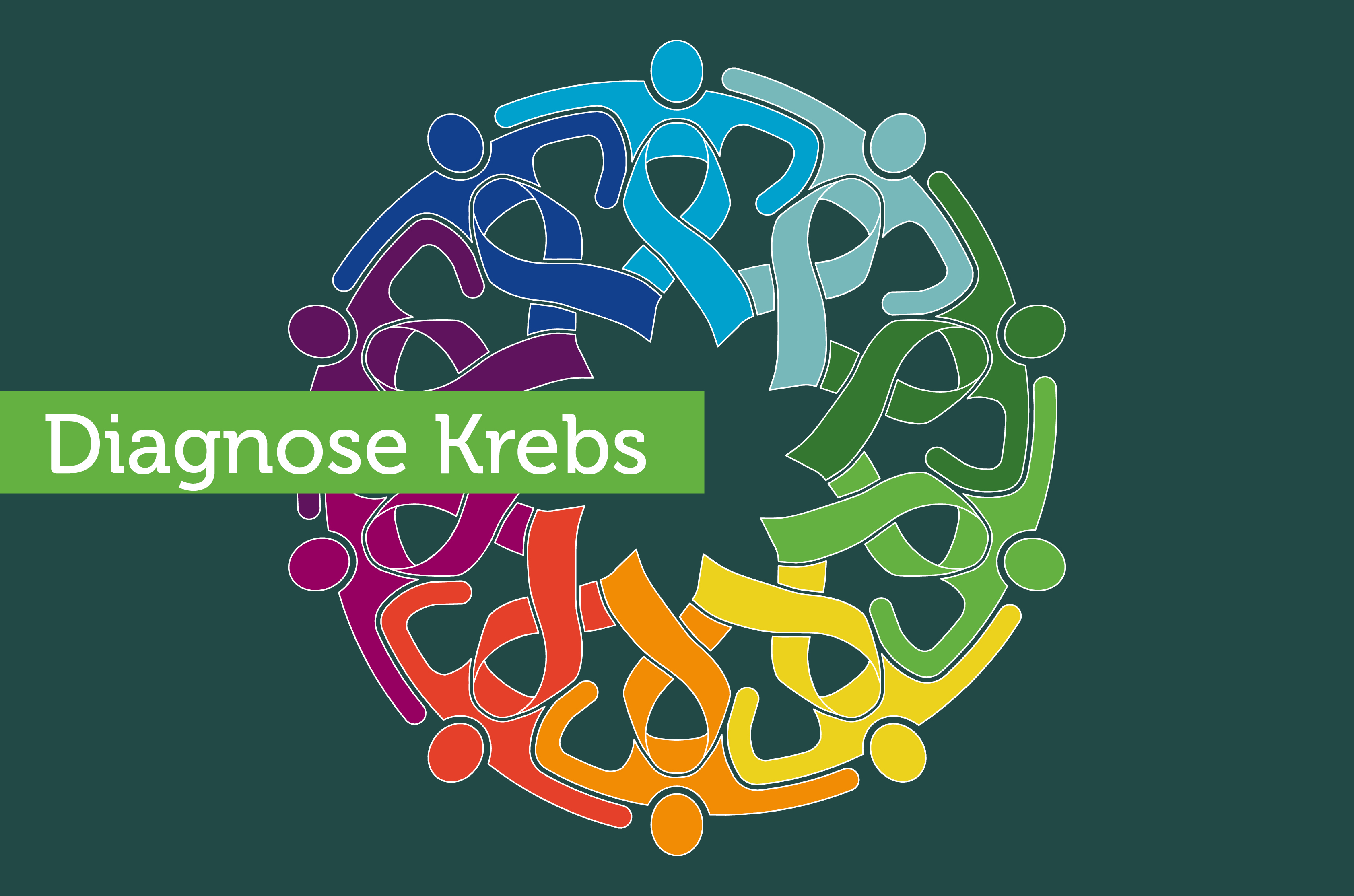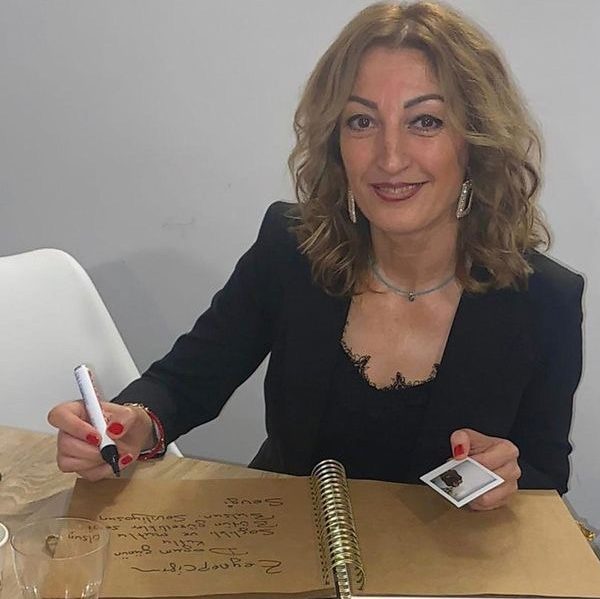In Deutschland erkranken jährlich rund 33.000 Männer und 28.000 Frauen an Darmkrebs, der zu den drei häufigsten Krebserkrankungen zählt. Lag bisher das mittlere Erkrankungsalter bei Anfang bis Mitte 70, so sind in den letzten Jahren zunehmend auch junge Menschen betroffen. Oft ist danach eine Stomaanlage notwendig.
Die Diagnose Darmkrebs ist zunächst für jeden Patienten ein Schock. Im frühen Stadium ist Darmkrebs eine gut behandelbare und in vielen Fällen heilbare Erkrankung.
Vorsorge wahrnehmen
Es ist ratsam, dass jeder die Angebote zur Vorsorge und Früherkennung wahrnimmt. Der Hausarzt informiert bei Auffälligkeiten, welche Untersuchungen angezeigt sind und wie diese verlaufen.
Ernstzunehmende Symptome sind zum Beispiel Blut im Stuhl, Stuhlunregelmäßigkeiten und/oder Gewichtsabnahme? Dann ist es höchste Zeit für einen Arztbesuch.
Die zuverlässigste Methode der Darmkrebsvorsorge ist die Darmspiegelung. Dies bestätigt eine aktuelle Studie aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Wenn mehr Menschen die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen, könnten in Deutschland jedes Jahr etwa die Hälfte aller Darmkrebs – Neuerkrankungen und Sterbefälle vermieden werden.
Für Menschen zwischen 50 und 55 Jahren übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für einen jährlichen Stuhltest. Zudem ist es im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung möglich ab einem Alter von 55 Jahren eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Gibt es keine Auffälligkeiten, kann man diese nach 10 Jahren wiederholen.
Was ist ein Stoma?
In Deutschland leben über 150.000 Stomaträgerinnen und -träger (Menschen mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung). Das Wort „Stoma“ kommt aus dem Griechischen, beschreibt zum einen Mund/ Öffnung, den Mund als Körperteil, zum anderen eine künstlich geschaffene Öffnung eines Hohlorgans. Zur Spezifizierung wird das Stoma mit der Organlokalisation (Colostoma am Dickdarm, Ileostoma am Dünndarm) bezeichnet. Es dient zur Ausleitung von Ausscheidungen.
Stoma tragen – anfangs oft schwer
Viele Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung zum Stomapatienten werden, reagieren oft mit Angst und Unsicherheit, viele leiden unter enormen Stress. Das Körperbild, die Auseinandersetzung mit der Grunderkrankung sowie die Auswirkungen im sozialen Umfeld, bringen den betroffenen Menschen in eine Extremsituation. Umso wichtiger ist die Beratung und Anleitung durch einen kompetenten Stomatherapeuten.
Hilfe mit Umgang bieten versierte Pflegefachkräfte
Die Stomatherapie ist ein Fachgebiet der Krankenpflege. Ihre Zielsetzung ist zuallererst die physische, psychische und soziale Rehabilitation der Betroffenen mit Stomaanlage (künstliche Stuhl- bzw. Harnableitung). Das heißt, die Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Funktionen durch fachgerechte Pflege, Beratung und Anleitung bis hin zur professionell organisierten Überleitung (Nachversorger). Die Stomatherapeuten werden regelmäßig in Fachweiterbildungen geschult und trainiert. Eine Grundvoraussetzung ist ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten, dessen Angehörigen und dem Stomaexperten.
Rehabilitation für Patienten mit Stoma in der Paracelsus Klinik am Schillergarten Bad Elster
Die Paracelsus Klinik am Schillergarten Bad Elster verfügt über alle Voraussetzungen, die für eine adäquate Therapie und Rehabilitation für Patienten mit Stomaanlage notwendig sind.
Ein interdisziplinäres Team unterschiedlicher Berufsgruppen aus Ärzten, Pflegefachkräften, auf die Versorgung von Stomaträgern spezialisierte Stomatherapeuten, Wundexperten, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern, Mitarbeiter der Sozialdienste, Psychologen und Psychoonkologen sind in unserer Rehabilitationseinrichtung für die Patienten da.
An der Versorgung der Stomapatienten sind speziell ausgebildete Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung beteiligt. Seit 2015 gibt es in der KLinik einen eigens entwickelten Stomaleitfaden zur Qualitätssicherung.
Hinzu kommen Angebote der Selbsthilfeorganisation ILCO, der größten deutschen Selbsthilfevereinigung von Stomaträgern, Menschen mit Darmkrebs und ihren Angehörigen, deren Anwesenheit alle drei Wochen fest in den Terminplänen verankert ist.
Schon am 1. Tag der Reha findet die ärztliche und stomatherapeutische Aufnahme statt.
Die stomaversierten Pflegefachkräfte informieren sich über die aktuelle Situation und über die bisherige pflegerische Betreuung des Patienten. Im Informationsaustausch erhält der Patient einen eigens erstellten Stomaflyer. In diesem sind alle wichtigen Informationen und Notfallkontaktdaten enthalten. Auch für den Fall, dass eventuelle Schwierigkeiten bei der Stomaversorgung auftauchen. Auf dem Flyer stehen weitere wissenswerte Fakten, so z.B. womit eine Stomatasche ausgerüstet sein sollte oder auch welche Fachabteilungen vor Ort für individuelle Beratung und Anleitung zur Verfügung stehen. Die Stomatherapeuten prüfen, ob der Patient genügend Stomamaterial für die nächsten Tage vorrätig hat und wie der Stand der Selbstständigkeit ist. Anschließend bespricht der behandelnde Arzt mit dem Patienten die individuellen Rehabilitationsziele. Das Therapieprogramm wird gemeinsam von Arzt und Patient besprochen und individuell erstellt.
Stomasprechstunde
Eventuelle Komplikationen wie Hautveränderungen am Stoma, Wundheilungsstörungen, Materialbestellung – ggf. Optimierung der Versorgung, besprechen die Stomaberater gemeinsam mit dem Patienten während der Stomasprechstunde. Diese findet geplant schon am Folgetag statt. Stomaberater und Patient besprechen und entwickeln gemeinsam die weiterführende Startegie.
Ziel der Stomatherapie ist die größtmögliche Rehabilitation der Betroffenen sowie die Selbstständigkeit in der Versorgung ihrer Stomaanlage.
Bedarfe und Bedürfnisse bestimmen den Weg
Noch vorhandene Ängste und Unsicherheiten werden erkannt und im Laufe des Aufenthalts reduziert. Standardisierte Abläufe sichern Wechselintervalle und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Die
Wir erhöhen schrittweise die Selbstständigkeit der Patienten durch angepasste individuelle Übungen im 4 – Stufen – Modell. Berücksichtigen muss man hier Pflegeprobleme, die zB. nach Chemotherapie (Parästhesien), bei motorischen Einschränkungen (nach Schlaganfall), Körperbildstörung, Demenz, vermindertem Allgemeinzustand und Ernährungszustand aber auch bei Sprachbarrieren, auftreten.
Sicherer Umgang am Ende der Rehabilitation
Mit viel Empathie und Geduld werden bei den Patienten Abhängigkeiten minimiert. Am Ende der Reha kennt der Stomapatient mögliche Komplikationen am Stoma und beherrscht den Umgang damit. Hilfsmittel, die bereits mit der Stomatasche im Akuthaus ausgehändigt wurden und deren Handhabung evtl. noch unklar war, werden erklärt. In speziellen Gesprächsgruppen wird über Stoma im Alltag berichtet. Körperpflege, Freizeitgestaltung und -möglichkeiten, Ratschläge zu Kleidung für Stomapatienten, zu Sexualität und Stomaversorgung nach der Reha werden thematisiert.
Auch nach der Reha nicht alleingelassen
Um die Qualität der Stomaversorgung auch nach der Reha zu garantieren, hat jeder Stomapatient ein Homecareunternehmen an seiner Seite, zu dem er jederzeit Kontakt aufnehmen kann.
Gemäß des Pflegestandards wird die Überleitung an den Nachversorger durch die Stomaabteilung unserer Klinik schriftlich und telefonisch vorgenommen. Einige Patienten leisten dies aber schon selbst.